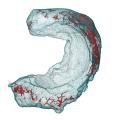Horizon Europe-Projekt "Heatwise" gestartet: Wärme aus dem Rechner
Verfasst von ictk am Fr, 12. April 2024 - 13:10Keine Wärme verschwenden: Dieses Ziel setzt sich ein Dutzend europäischer Firmen und Forschungsinstitutionen, darunter auch die Empa, im EU-Projekt "Heatwise". Im Mittelpunkt stehen Gebäude mit umfangreicher IT-Infrastruktur. Die Abwärme dieser Systeme soll vollständig in die Gebäudetechnik integriert werden.